Rahmenbedingungen für die Fachentwicklung
und Fragen muslimischen Lebens
Rahmenbedingungen für die Fachentwicklung
und Fragen muslimischen Lebens

Die AIWG erforscht und erörtert im Forschungsbereich „Islam und Theologie im Kontext“ übergeordnete Fragen zur Entwicklung des islamisch-theologischen Fachbereichs und muslimischen Lebens in Deutschland und Europa unter dem Einfluss gesellschaftlicher und akademischer Erwartungen und Entwicklungen.
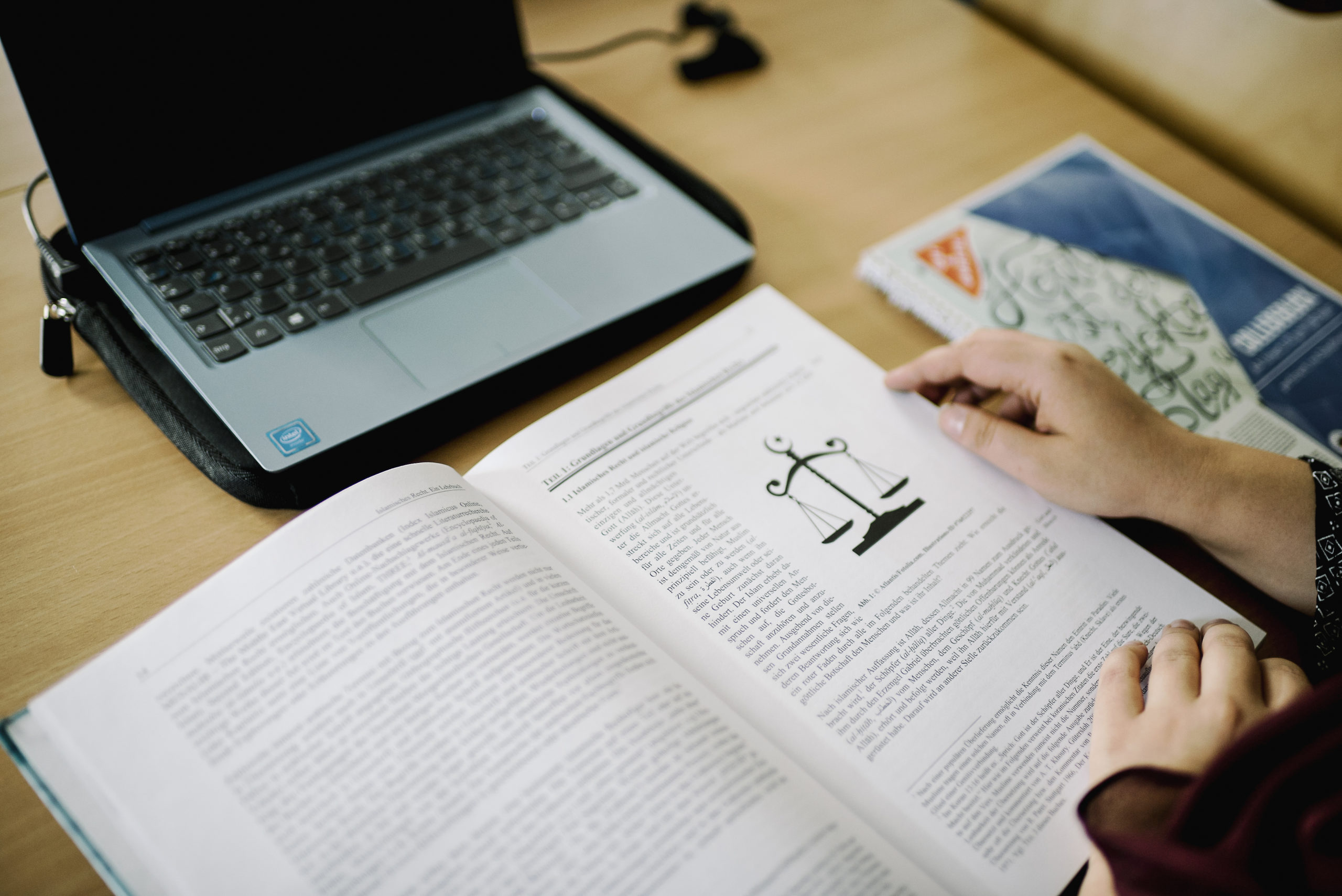
Unser Forschungsbereich Islam und Theologie im Kontext widmet sich:
Der Forschung und Diskussion in diesem Bereich liegen verschiedene Fragestellungen zugrunde: Mit Bezug auf den Bildungssektor, insbesondere Wissenschaft und Hochschule, interessieren Fragen der Fachentwicklung in den islamisch-theologischen Subdisziplinen und der Religionspädagogik: Wie gestalten sich innerfachliche Beziehungen? Wo zeigen sich neue Entwicklungen und Neuausrichtungen theologischer und religionspädagogischer Erkenntnisinteressen? Und wie lassen sich diese in das breitere Feld der Theologie, der Sozial- und Religionswissenschaften einordnen? In welchen gesellschaftlichen Konstellationen – die sich dynamisch verändern – bewegt sich die Fachentwicklung, und welche wissenschaftlichen Konzepte liegen Begriffen vom Islam und von Muslim_innen zugrunde?
Zusätzlich legen die zuständigen Wissenschaftler_innen an der AIWG besonderes Augenmerk auf Analysen und Beiträge zum Verhältnis zwischen Politik und Muslim_innen unter sich wandelnden kontextuellen Bedingungen und fragen, wie sich deren Geschichte in Deutschland bewahren und abbilden lässt. Es bildet den Kontext u.a. für die wissenschaftliche Bearbeitung islamisch-theologischer und religionspolitischer Themen und für ihren Praxistransfer.
Beschreibung folgt / Leitung: Bekim Agai und Raida Chbib
Das Analysefeld untersucht das Verhältnis zwischen Politik und Muslim_innen in Deutschland mit einem Fokus auf Beschreibung und Analyse politischer Kommunikation von Parteien, Parlamentarier_innen und Regierungen (Landes- und Bundesministerien), und damit auch der Strategien, Entscheidungsprozesse und Rechtsakte staatlicher Akteur_innen zu religionsbezogenen Fragen. Im Zentrum steht die übergeordnete Frage, wie eine zeitgemäße Religionspolitik in einer pluralen demokratischen Gesellschaft adäquat ausgestaltet sein sollte.
Leitung: Raida Chbib
„Kulturelles Gedächtnis des Islams in Deutschland – Eine Erschießung durch Gemeindearchive“
Die Geschichte des Islams in Deutschland ist lange Zeit entlang der Quellen der Mehrheitsgesellschaft geschrieben worden. Wer gründet einen Verein? Wo wird eine Immobilie gekauft? Wer tritt mit staatlichen oder kirchlichen Stellen in Kontakt? Welche Gruppen werden bei staatlichen Anlässen repräsentiert, welche von staatlichen Stellen problematisiert?
Aber jede Gemeinde hat ihre eigene Geschichte, die sich in internen Schriftwechseln, Protokollen, Einladungsschreiben, Curricula, in benutzten Büchern, Kassetten oder im Mobiliar niederschlägt. Das Projekt „Kulturelles Gedächtnis des Islams in Deutschland – Eine Erschießung durch Gemeindearchive“ versucht eine Geschichte „von unten“ zu schreiben, welche sich aus der Sicht der Akteur_innen selbst ergibt. Dazu werden gezielt auch Gemeinden für die Herausforderung der Archivsicherung sensibilisiert und in dem Aufbau von Archiven geschult, um die Materialien für die Erinnerung der eigenen Geschichte und für eine wissenschaftliche Bearbeitung gleichermaßen zu sichern.
Leitung: Bekim Agai
Islam und Muslim_innen – Ko-Konstruktion von Islamizität in Konstellationen institutioneller und wissenschaftlicher Nachbarschaft
Die Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit des Begriffs „Islam“ wird schon in den unterschiedlichen Bedeutungen ersichtlich, mit denen wissenschaftliche Disziplinen ihn als Forschungsgegenstand bestimmen: Während die Islamische Theologie Islam als ein System normativer und präskriptiver Ableitungen aus fundamentalen Glaubenszeugnissen betrachtet, das zudem disziplinabhängig unterschiedlich akzentuiert wird, arbeitet die Islamwissenschaft mit einem weitgehend kulturorientierten und zivilisatorischen Islambegriff; Ethnologie und Soziologie untersuchen hingegen den Alltag und das soziale Handeln von Muslim_innen, und die Religionswissenschaft wiederum fragt, was Muslim_innen selbst unter ihrer Religion verstehen. Dabei gerät außer Acht, dass „Islam“ im Sinne einer Ko-Konstituierung nicht nur autoreferentiell, sondern auch in verschiedenen Beziehungskonstellationen in konkreten historischen Situationen Gestalt annimmt und sich verändert.
Die Forschung greift diesen relationalen Aspekt der Selbstverständigung im pluralistischen Umfeld auf und fragt nach der Konstruktion und damit Neu-Definition von Islamizität im modernen, säkularen Kontext Deutschlands seit der Zwischenkriegszeit bis heute. Ziel ist es, in einem religionsgeschichtlichen und diskursanalytischen Zugriff zu untersuchen, wie einerseits religionsgemeinschaftliche muslimische Akteur_innen in Deutschland durch Selbstverortung, Organisationsformen, religiöse Selbstlegitimierung und Ausdrucksweisen sowie öffentliches Handeln das Konzept „Islam“ aktiv gestaltet haben, und welche Rolle dabei ihre Einbettung in nachbarschaftliche Konstellationen zu Institutionen anderer Religionen, zum weiteren säkularen Umfeld und zu staatlichen/lokalen behördlichen Strukturen gespielt haben.
Leitung: Bekim Agai
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen