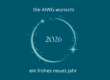Ausstellung und Podiumsdiskussion zum interreligiösen Dialog
Unter dem Titel „Erzähl mir von deinem Propheten“ fand am 10. Oktober 2025 in der Islamischen Gemeinde Wilhelmsburg (IGW) in Hamburg eine Ausstellung mit anschließender Podiumsdiskussion statt. Die Ausstellung zeigte Plakate von Schüler_innen der Gemeinde, die ihre persönlichen Zugänge zum Propheten Muhammad darstellten. Die Veranstaltung, die im Rahmen der Hamburger Islamwoche 2025 stattfand, war mit rund 100 Gästen gut besucht.
Mustafa Çetinkaya, Theologe und Imam der Gemeinde, organisierte die Veranstaltung im Rahmen der AIWG-Forschungsgruppe „Mit dem Propheten Muhammad ins Gespräch kommen“ in Kooperation mit der Schura Hamburg. Prof. Dr. Mohammad Gharaibeh vom Berliner Institut für Islamische Theologie und Teil der Projektleitung, eröffnete die Ausstellung.
Plakate zu Hadithen und Prophetenbild
In der Moschee waren sieben Plakate ausgestellt, die Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren gestaltet hatten. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften hatten sie Textauszüge aus Hadithsammlungen ausgewählt und gekonnt visualisiert. Als Quellen dienten unter anderem Prophetenaussprüche tradiert von Ṣaḥīḥ al-Buḫārī und Ṣaḥīḥ Muslim. Die Lehrer_innen beantworteten Fragen des Publikums, das vor den Plakaten ins Gespräch kam. Die Themen der Plakate umfassen soziale Werte wie Liebe, Respekt, Zusammenhalt und Gleichheit, ethisch-moralische Kategorien wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Vergebung sowie persönliche Tugenden wie Geduld und Dankbarkeit. Auch Frieden und Tierliebe wurden thematisiert.
Teil des Unterrichtskonzepts war außerdem die Auseinandersetzung mit anderen Religionen: Die Schüler_innen setzten sich mit dem Christentum auseinander und erarbeiteten anhand dieses Vergleichs das Thema Barmherzigkeit. Deutlich wurde, dass die Jugendlichen den Propheten als Orientierung für ihr alltägliches Handeln und ihre Wertevorstellungen begreifen.
Podiumsdiskussion: „Prophetenbilder zwischen Tradition und Gegenwart“
Im Anschluss an den Ausstellungsrundgang diskutierten Imam Abdussamet Demir, Pastorin Rebecca Assif, IRU-Lehrkraft Kadir Capan, Gemeindepädagogin Buket Okumus und Prof. Dr. Mohammad Gharaibeh, unter der Moderation von Özlem Nas (Schura Hamburg). Im Mittelpunkt standen die Erfahrungen muslimischer Jugendlicher in Schule und Moschee, der Einfluss medialer Darstellungen auf die Prophetenwahrnehmung, die Rolle des Islamischen Religionsunterrichts beim Abbau von Vorurteilen sowie Fragen der Vielfaltsakzeptanz und des interreligiösen Dialogs.
Unterschiedliche Lernorte: Schule und Moschee
Gemeindepädagogin Buket Okumus betonte gemeinsam mit Özlem Nas die unterschiedlichen Schwerpunkte beider Lernorte: Im schulischen Religionsunterricht lernen muslimische Jugendliche unter anderem ihre Religion sprechfähig zu vertreten und erwerben fundiertes Wissen über die eigene Religion. Dabei gehe es vornehmlich um die Frage, wie der Prophet verstanden werden könne. Die Gemeinde biete hingegen einen Raum für die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Religiosität und für einen emotional-spirituellen Zugang zum Propheten Muhammad. Im Zentrum der Diskussion stand, welche Schwerpunkte im Schul- oder Gemeindeunterricht gesetzt und wie diese unterschiedlichen Zugänge methodisch aufgefangen werden – etwa ob der Prophet eher als moralisches Vorbild, als spirituelle Persönlichkeit oder als Begründer religiöser Regeln und Lebensführung vermittelt wird.
Medienbilder und Perspektivwechsel
Mit Blick auf die ausgestellten Plakate schilderte Pastorin Rebecca Assif, dass sich ihre Perspektive auf den Propheten Muhammad verändert habe. Zuvor habe sie ihn vor allem mit Strenge, Autorität und Demut assoziiert, so wie er oft in medialen Darstellungen erscheine. Die in der Ausstellung gezeigten Themen wie Liebe, Barmherzigkeit und Respekt hätten ihren Blick erweitert.
Diese Reflexion führte zu einer Diskussion mit dem Publikum über den Einfluss von Medienbildern auf Jugendliche: Welche medialen und gesellschaftlichen Narrative prägen das öffentliche Bild des Propheten Muhammad? Und warum weicht dieses Bild oft ab von dem, was in muslimischen Gemeinden vermittelt wird? Als möglichen Ansatz, dieser Diskrepanz zu begegnen, hob Buket Okumus die Vorbildfunktion von Gemeindelehrkräften hervor: „Wenn ich vom Propheten als einer Person spreche, die gerecht ist, sollte ich selbst darauf achten, gerecht zu sein.“ Durch diese authentische Vorbildfunktion könne das Bild des Propheten auch auf die Jugendlichen wirken. In diesem Zusammenhang wurde diskutiert, ob und wie der Islamische Religionsunterricht in öffentlichen Schulen solche Diskrepanzen aufgreifen sollte: Wie können Schüler_innen zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich verbreiteten Darstellungen befähigt werden? Welche Chancen, aber auch Grenzen, ergeben sich daraus für den schulischen Kontext?
Interreligiöser Dialog und Vielfaltsakzeptanz
Pastorin Rebecca Assif dankte für den Einblick in die praktische Bildungsarbeit mit muslimischen Jugendlichen und regte an, Konfirmand_innen und Schüler_innen der Gemeinde künftig zusammenzubringen. Ziel dabei sei, dass Jugendliche verschiedener religiöser Hintergründe miteinander ins Gespräch kommen, Vorurteile abbauen und ein differenziertes Verständnis religiöser Vorbilder entwickeln.
Ausgehend von den Arbeiten der Schüler_innen wurde zudem das Thema Vielfaltsakzeptanz diskutiert. Dabei wurde herausgestellt, dass muslimischen Gemeinden häufig gesellschaftliche Toleranz und Offenheit abverlangt werde, gleichzeitig die Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Religion allgemein – und dem Islam im Besonderen – jedoch abzunehmen scheine.
„Die Vereinigung der Hamburger Religionslehrer_innen“ plant, die erstellten Plakate künftig im Unterricht einzusetzen, um interkulturelle Begegnung und den Austausch über religiöse Vorbilder zu fördern. Das Konzept soll nach dem Hamburger Vorbild auch mit muslimischen Gemeinden in Berlin umgesetzt werden.
Über die AIWG-Forschungsgruppe
Die AIWG-Forschungsgruppe „Mit dem Propheten Muhammad ins Gespräch kommen“ untersucht an den Standorten Tübingen, Berlin und Gießen die Bedeutung von Hadithen als Medium der dialogischen Begegnung mit dem Propheten. Weitere Informationen zu unserer Forschungsgruppe können Sie hier nachlesen.