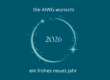Forschungsgruppe Islam und Digitalität auf dem 35. Deutschen Orientalistentag
Welche Rolle spielt Geschichte in der Identitätskonstruktion von Muslim_innen online? Wie vermitteln muslimische Gläubige islamische Ethik und Frömmigkeit in audiovisuellen Medien? Wie können digitale Forschungsmethoden zur Erschließung der Hadithliteratur genutzt werden und wie nutzen Muslim_innen Prophetenüberlieferungen im digitalen Raum?
Diesen Kernfragen widmete sich die AIWG-Forschungsgruppe „Islam und Digitalität“ im September in drei Panels auf dem 35. Deutschen Orientalistentag, der vom 08. bis 12. September an der FAU Erlangen-Nürnberg stattfand. Das vom Frankfurter Standort ausgerichtete Panel zu historischen Online-Diskursen umfasste drei Beiträge aus der Gruppe: Ein Vergleich der Darstellung historischer Schlüsselereignisse des Kolonialismus im Mittleren Osten und in Südasien im Online-Diskurs revivalistischer Sunniten ergab, dass randständige Gruppen koloniale Umwälzungen negativ beschreiben, während der jeweilige Mainstream gar nicht oder im Kontext eigener anti-kolonialer Geschichte positiv Bezug nimmt. Weiter gefasst ist eine Untersuchung zu Darstellungen muslimischer Geschichte auf YouTube. Dieser plattformspezifische Online-Diskurs fokussiert sich weniger auf Ereignisse, denn auf historische Persönlichkeiten. Dabei kommt der Frühzeit des Islams, insbesondere dem Propheten Muḥammad, eine besondere Bedeutung zu. Eine Aktualisierung personenbezogener Bildsprache konnte im Vortrag zu schiitischen Martyriumsdarstellungen auf Instagram aufgezeigt werden. Traditionelle Darstellungen der schiitischen Imame dienen etwa auf Instagram im Kontext unterschiedlich politisch aufgeladenen Bildmaterials zeitgenössischer Akteure als Marker für deren Martyrium.
Das Erfurter Teilprojekt zu audio-visuellen Ästhetiken stellte seine Forschung mit zwei Beiträgen beim Panel vor. Der Blick auf die Social Media Praxis von Influencer_innen aus dem Umfeld der Ahmadiyya Muslim Jamaat machte deutlich, dass Akteur_innen audio-visuelle Darstellungsformen je nach Plattform sowie Thema variieren und darüber hinaus auf nicht-religiöse Onlinekultur Bezug nehmen. Die Verwendung von AI in der Videoerstellung für islamische Inhalte war Thema des zweiten Beitrags. Eine breite Verwendung von AI lässt sich in diesem Kontext nachweisen, die verwendete Bildsprache ist aber offenkundig westlicher (Pop-)Kultur entnommen. Ergänzt wurde das Panel der Forschungsgruppe durch einen Beitrag von Dr. Ülker Sözen, Universität Leipzig. Sie referierte zur audiovisuellen Vermittlung von Liebe, Sexualität und Frömmigkeit in türkischsprachigen Inhalten auf TikTok. Sözen machte deutlich, dass islamkonforme Liebe ein wichtiges Narrativ innerhalb der eher jugendlichen Zielgruppe darstellt. Auch Dr. Fouad Gehad Marei, der neue Forschungsfellow der Gruppe „Islam und Digitalität“ stellte im Kontext des Orientalistentages sein Projekt vor. Er forscht seit Anfang Juli anhand der App „VR Karbala“ zu virtueller Realität im Islam. Sein Vortrag behandelte unter anderem die Frage, ob VR in der Ritualpraxis als Ersatz für tatsächliche Handlungen dienen kann. Während Marei in schiitischen Gemeinden und Heiligtümern eine zunehmende Nutzung von VR nachweisen konnte, sehen Gemeindemitglieder in entsprechenden Angeboten keinen Ersatz, sondern nur eine Ergänzung traditioneller Riten.
Im dritten Panel der Forschungsgruppe beleuchtete das Teilprojekt an der Humboldt-Universität zu Berlin Prophetenüberlieferungen im digitalen Raum. Ein Beitrag stellte das Potential von künstlicher Intelligenz in der Hadithforschung vor. Die Fallstudie zu dem 8. zwölferschiitischen Imam ʿAlī ar-Riḍā zugeschriebenen Werk Ṣaḥīfah ar-Riḍā, verwendet künstliche Intelligenz, um die – auch überkonfessionelle – Verbreitung der enthaltenen Prophetenüberlieferungen nachzuzeichnen und Varianten zu identifizieren. Hadith-Datenbanken und spezifisch für den Umgang mit Hadithen ausgelegte Apps waren Thema des zweiten Vortrags. Gängige Hadith-Datenbanken bieten durch die Onlinestellung relevanter Hadithsammlumgen breiten Zugang zu dieser Quellengattung, sind aber je nach Herkunft und staatlicher Förderung häufig konfessionell schiitisch oder sunnitisch geprägt. Über die reine Bereitstellung des Textes hinaus gehen Hadith-Apps, die die Prophetenüberlieferungen etwa themenspezifisch innovativ clustern und damit neue Sinnzusammenhänge vorschlagen.
Die Forschungsgruppe „Islam und Digitalität“ tagt vom 05. bis 07. November in Frankfurt. Ein der akademischen Öffentlichkeit digital zugänglicher Teil der Veranstaltung ist in Planung.
Das Projekt „Islam und Digitalität: Medien, Materialität, Hermeneutik“ wird gemeinsam umgesetzt von Wissenschaftler_innen der Islamischen Theologie an der Humboldt Universität zu Berlin, der Goethe-Universität Frankfurt und der Universität Erfurt im Rahmen der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG). Es wird gefördert durch das BMFTR.
Mehr zum Forschungsprojekt können Sie hier nachlesen.