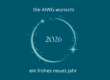ITS-Colloquium blickt multiperspektivisch auf islamischen Feminismus
„Islamic Feminism: Exploring Boundaries and Embracing Possibilities“ unter diesem Titel fand Ende November das nunmehr dritte ITS-Colloquium der AIWG an der Goethe-Universität Frankfurt statt. Islamischer Feminismus ist eine der am meisten diskutierten intellektuellen Strömungen in der islamischen Welt. Unter der Organisation von Dr. Mansooreh Khalilizand, Universität Freiburg, Prof. Dr. Kata Moser, Universität Göttingen, und Prof. Dr. Abbas Poya, Universität Erlangen-Nürnberg, präsentierten acht Wissenschaftlerinnen die Frage, wie islamischer Feminismus in der Theorie verstanden werden könne, und in welche Richtung eine weitere Entwicklung wünschenswert wäre. Das international besetzte Colloquium zielte darauf ab, Islamischen Feminismus aus der verengten Perspektive der feministischen Koranhermeneutik zu lösen und zudem Positionen aus dem globalen Süden hervorzuheben.
Der Workshop startete mit einem Impuls von Prof. Dr. Sedigheh Vasmaghi, einer renommierten Expertin für islamisches Recht im Iran und einer Verfechterin der geschlechtergerechten Auslegung der islamischen Quellen in der Rechtsprechung. Angesichts ihrer ernüchternden Erfahrungen im männlich dominierten Rechtsdiskurs im Iran widerlegte sie in ihrem Vortrag die gängige Lehrmeinung des göttlichen Ursprungs der islamischen Jurisprudenz (fiqh). Nur mit diesem Verständnis, so Vasmaghi, könne die islamische Jurisprudenz berechtigterweise im Einklang mit dem historischen Paradigmenwechsel hin zur Gleichstellung der Geschlechter, der sich im 20. Jahrhundert allmählich durchgesetzt hat, geändert werden.
Daran anschließend ergründete Prof. Dr. Ravza Altuntaş Çakır von der Marmara Universität in Istanbul in ihrem Vortrag das Potenzial einer feministisch orientierten anti-essentialistischen Neubeurteilung des Islams, um eine religionsbasierte Gleichberechtigung der Geschlechter gegen die Auffassung des „male-stream“ zu verteidigen. Die „male-stream“ Auffassung – also die von Männern geprägte „main-stream“ Position – würde bisher islamische Quellen essentialistisch und im Widerspruch zum feministischen Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit auslegen. Nach der Präsentation von Positionen zeitgenössischer türkischer Feministinnen skizzierte die Politologin und Soziologin ihren eigenen Vorschlag der Koranauslegung, der von einer komplexen Fluidität und Reziprozität von Bedeutungen in religiösen Texten ausgeht.
In welcher Weise die arabische Sprache und arabische Lesegewohnheiten gewandelte Normen einer geschlechtergerechten Sprache akkommodieren können und an welche Grenzen Übersetzungen stoßen, beleuchte Prof. Dr. Randa Aboubakr von der Universität Kairo in ihrem Beitrag. Am Beispiel der Verwendung des Pronomens „sie“ für Gott zeigte die vergleichende Literaturwissenschaftlerin und langjährige Übersetzerin aus dem Englischen ins Arabische, dass bestimmte neue Ausdrucksweisen besondere Überzeugungsarbeit erfordern, um in Büchern Eingang zu finden.
Prof. Dr. Marziyeh Bakshizadeh von der Theologischen Hochschule Reutlingen hat sich kritisch mit dem Ansatz der „feministischen Hermeneutik des Korans“ befasst. Vertreterinnen dieses Ansatzes fordern, den fundamentalen koranischen Text aus feministischer Perspektive neu zu interpretieren, etwa indem intertextuelle Gesichtspunkte, der Kontext der Offenbarung oder die Qualitäten Gottes besonders berücksichtig werden. Nach ihrer kritischen Analyse hat die Theologin einen erweiterten Rahmen für den islamischen Feminismus vorgeschlagen. Sie plädierte für einen Paradigmenwechsel, der den patriarchalen Charakter der Gesellschaft zur Zeit des Propheten anerkenne. Ihrer Argumentation zufolge war der Prophet, als Produkt seiner Gesellschaft, zwangsläufig von deren dominanten Werten geprägt. Es sei daher nicht realistisch zu erwarten, dass er die patriarchalen Strukturen und Werte seiner Zeit und seines Umfelds vollständig überwinden konnte.
Dr. Mansooreh Khalilizand von der Universität Freiburg stellte in ihrem Beitrag Mulla Sadra’s Offenbarungstheorie vor, die sich besonders gut dazu eigne, aus der „hermeneutischen Sackgasse“ im Ansatz der „feministischen Hermeneutik des Korans“ herauszufinden. Die Philosophin analysierte zunächst das Konzept der sogenannten „hermeneutischen Sackgasse“. Die gängige Lehrmeinung besagt, der Koran sei das Wort Gottes, was die Interpretation offensichtlich misogyner Stellen erschwert. Sie zeigte anschließend auf, wie dieses Dogma von muslimischen Philosophen wiederholt hinterfragt wurde, indem sie die aktive Rolle Mohammeds bei der Entstehung der Schrift betonten. Mulla Sadra’s Offenbarungstheorie, so Khalilizand, ermögliche es, einerseits über eine bloss wortwörtliche Lesart der Schrift hinauszugehen und andererseits zu verhindern, dass patriarchale und androzentrische Verse Allah selbst zugeschrieben würden.

Einen Einblick in die unterschiedlichen feministischen Strömungen Marokkos gab Prof. Dr. Aicha Barkaoui von der Universität Hassan II in Casablanca. Für Marokko konstatierte die Wissenschaftlerin, die sich in zahlreichen feministischen Gruppen in Afrika und in der Frankophonie einbringt, einen interessanten Befund. So werde gerade der islamische Feminismus in Marokko häufig unter Generalverdacht gestellt, mit der Regierung zu kollaborieren. Da auch säkularer Feminismus als problematisch wahrgenommen werde, sei hier die in Marokko einmalige feministische Bewegung des Dritten Weges vielversprechend, die die schwierige Position der marokkanischen Frau in Recht und Gesellschaft als Intersektion verschiedener Unterdrückungsmechanismen bewertet.
Das Agency-Paradoxon, das verhindere, dass aus der Perspektive eines säkularen westlichen Feminismus Vertreter_innen des islamischen Feminismus Handlungssouveränität zugesprochen werden kann, adressierte Clara Bauer in ihrem Beitrag. Sie analysierte, wie der weiße westliche Feminismus die Erfahrungen und Kämpfe muslimischer Frauen durch eine imperiale Konstruktion von Handlungsmacht unsichtbar gemacht und unterdrückt hat. Vereinfachte und eurozentrische Dichotomien wie Widerstand/Unterwerfung oder Freiheit/Unterdrückung des westlichen hegemonialen Feminismus würden subalterne Formen von Handlungsmacht auslöschen. Ausgehend hiervon deutete Bauer lokale Aktivitäten palästinensischer Feministinnen in ihrer Handlungsmacht als ein historisch geprägtes Konzept und in ihren komplexen Bedeutungen und Funktionen in den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Frauen.
Das Verhältnis von arabischen Säkularismustheorien und arabischen Feminismus, insbesondere islamischen Feminismus, beleuchtete die Arabistin und Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Kata Moser von der Universität Göttingen. Während in der arabischen Welt an der Wende zum 20. Jahrhundert feministische und säkulare Diskurse eng miteinander verknüpft gewesen seien, wären im zeitgenössischen Diskurs Frauen als Theoretikerinnen und Thema der Säkularismustheorie abwesend. Moser plädierte dafür, islamischen Feminismus mit Säkularismustheorien wieder zusammenzubringen und die gegenseitigen Bezüge zu betonen.
Die Bandbreite der vorgestellten Themen und Thesen wurden von regen Diskussionen begleitet, in der die regionale Vielfalt des islamischen Feminismus in der islamischen Welt deutlich zutage trat. Zugleich wurden auch die trotz der lokalen Diversität überall gleichermaßen geltenden grundlegenden theoretischen Erwägungen und gegebene Dringlichkeit der adressierten Herausforderungen sichtbar. Ihnen allen liegt zugrunde, dass die männliche Dominanz in normgebenden religiösen Diskursen weiterhin stark präsent ist. Dennoch eröffnen sich Möglichkeiten für islamische Feministinnen, durch ihre langjährigen Bemühungen und wachsende Expertise zunehmend als Religionsgelehrte und Theoretikerinnen Gehör zu finden und ihre Anliegen nach Geschlechtergerechtigkeit auf verschiedenen Ebenen wirksam zu vertreten und weiterzuentwickeln. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen haben ihr Interesse bekundet, den Austausch über diese und weitere Fragen des islamischen Feminismus auch in weiteren Treffen gemeinsam zu ergründen.