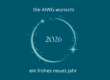ITS-Colloquium lotet Ressourcen für Resilienz in islamischer Tradition aus
Der Begriff „Resilienz“ gewinnt in der Bewältigung persönlicher Krisenerfahrungen zunehmend an Bedeutung. Während zu diesem Konzept in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bereits intensiv geforscht wird, fehlt bislang eine fundierte und systematische Auseinandersetzung aus islamisch-theologischer Sicht.
Im Rahmen des Formats „ITS-Colloquium“ der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft fand deshalb vom 27. bis 28. März 2025 in Münster die Fachtagung „Ressourcen für Resilienz in islamischer Tradition. Theologische, ethische und mystische Perspektiven“ statt. Unter der Leitung von Dr. Stephan Kokew, Paderborner Institut für Islamische Theologie, und PD Dr. Raid Al-Daghistani, Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster, wurden verschiedene Ressourcen für Resilienz in der islamischen Geistestradition identifiziert und mit acht Wissenschaftler_innen in einem interdisziplinären und interreligiösen Rahmen kritisch reflektiert. Die Fachtagung ging dabei von dem Grundsatz aus, dass sich Ressourcen für Resilienz aus der eigenen Glaubenstradition heraus begründen lassen. Hierbei sollten Ausgangspunkte aus den bereits entwickelten Forschungsansätzen anderer Disziplinen, insbesondere der beiden großen christlichen Theologien, als Orientierungsansätze für eine Auslotung des Themenfeldes „Resilienz“ im islamischen Kontext dienen.
In dem einführenden Vortrag von Dr. Stephan Kokew wurde der Begriff „Resilienz“ aus einer vergleichenden begriffsgeschichtlichen Perspektive beleuchtet. Hierbei wurden Bedeutungen von „Widerstandskraft“ und der „Rückkehr in einen ursprünglichen Zustand“ als semantische Merkmale des Resilienz-Begriffs identifiziert und Krisen- und Scheitererfahrungen als Vorbedingungen für die Aktivierung von Resilienz hervorgehoben. Gleichzeitig wurde verdeutlicht, das in arabisch-islamischen Sprachkontexten der Begriff „Resilienz“ überwiegend durch das Wort „al-murūna/al-murūna an-nafsīya“ wiedergegeben wird, das seiner Begriffsgeschichte zufolge eher einen flexiblen und auf Anpassung abzielenden Umgang mit einer Gegebenheit meint, um diese für sich selbst besser beherrschbar zu machen.
Religion nicht per se Resilienzressource
Dr. Katharina Opalka, Universität Bonn, eröffnete dann eine protestantisch-theologische Perspektive auf Resilienz im Umgang mit Krisensituationen. Ausgehend von den Ergebnissen der DFG-Forschungsgruppe „Resilienz in Religion und Spiritualität“ hob sie das Spannungsfeld zwischen Hoffnung und der Integration von Negativität als zentrales Element eines resilienten Krisenprozesses hervor und betonte dabei die medio-passiven Formen des Aushaltens und Gestaltens eines resilienten Umgangs mit Krisen. Sie stellte dabei heraus, dass insbesondere die Erzählung von der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz im Markusevangelium als Narrativ für einen resilienten Umgang mit persönlichen Krisensituationen verstanden werden kann.
Im Anschluss eröffnete Dr. Adam Shehata, Sigmund Freud Privatuniversität Wien, in seinem Vortrag die Frage, welche Rolle islamisch-religiöse Vorstellungen in der Resilienzförderung bei Muslim_innen spielen können. Er betonte, dass Religion nicht per se als Resilienzressource verstanden werden könne. Vielmehr seien es bestimmte Haltungen und Überzeugungen, die sich aus religiösen Konzepten speisen, welche Resilienz fördern können, wie qaḍāʾ wa qadar (göttliche Vorhersehung) oder riḍā (Zufriedenheit). Shehata hob zudem hervor, dass muslimische Gelehrte unterschiedlicher Disziplinen wie Abū Zayd al-Balḫī (gest. 934), Ibn Sīnā (gest. 1037) oder al-Ġazālī (gest. 1111) in ihren Werken psychische Gesundheit und theologische Reflexion vielfach miteinander verwoben hätten. Zeitgenössische Forschende würden häufig auf Texte dieser Tradition zurückgreifen. Es gelte daher, diese Tradition neu zu erschließen und sie an moderne Erkenntnisse anzupassen.
Mystik als Ressource für Resilienz
Die anschließenden Vorträge hoben das Potenzial der islamischen Mystik (at-taṣawwuf) als Ressourcen für Resilienz hervor. Prof. Dr. Tuba Işık, Berliner Institut für Islamische Theologie, wies auf die Rolle des religiösen Gesangs in mystischen Traditionen als Mittel zur Resilienzförderung hin. Işık betonte, dass hierbei Gesang über das rein Musikalische hinausgehe und ein Instrument zur Selbstregulation und Selbsterkenntnis darstelle. Gemeinschaftliches Singen spiritueller Texte würde somit emotionale Stärke und innere Ruhe fördern, weshalb Mystiker wie Yunus Emre (gest. 1321) oder Haci Bayrami Veli (gest. 1430) Gesang gezielt als Medium nutzen würden, um metaphysische Dimensionen zu eröffnen und Sinnhaftigkeit in schwierigen Situationen zu finden.
PD Dr. Raid Al-Daghistani konzentrierte sich auf die Bedeutung der islamischen Konzepte ṣabr („Geduld“) und tawakkul („Gottvertrauen“) innerhalb der islamischen Mystik, und stellte dies als zwei Modi der Resilienzhaftigkeit gegen Heimsuchungen und Prüfungen dar, insofern sie zur Geistesstärke, inneren Stabilität, existenziellen Gelassenheit und Hoffnung führen. Al-Daghistani zufolge beziehen sich beide Konzepte auf die innere (bāṭin) als auch auf die äußere (ẓāhir) Dimension der menschlichen Existenz und bedeuten somit Resilienz gegenüber äußeren Umständen in gleichem Maße wie gegenüber inneren Zuständen des Menschen. Aufgrund ihres zentralen Stellenwertes in der islamischen Mystiktradition ließen sich Al-Daghistani zufolge insbesondere diese beiden Konzepte als Elemente einer eigenen islamischen Resilienzmystik verstehen.
Die katholische Theologin Prof. Dr. Hildegund Keul, Universität Würzburg, widmete sich am zweiten Tagungstag als Key-Speakerin dem Verhältnis von Mystik und menschlicher Verwundbarkeit (Vulnerabilität) in der christlich-katholischen Tradition. Keul machte in ihrem Vortrag deutlich, dass Mystik und Vulnerabilität bei Vertreter_innen der christlichen (Mechtild von Magdeburg, Thomas Merton) wie auch der islamischen Mystik (Rumi) schon immer zusammengedacht worden sind. Sie warnte jedoch auch vor der Möglichkeit missbräuchlicher Auslegungen und plädierte für eine kritische Auseinandersetzung damit.
Daniel Roters, Universität Münster, beleuchtete anschließend in seinem Vortrag das Verhältnis von Resilienz und Vulnerabilität aus der Sicht einer islamischen praktischen Theologie. Roters stellte die Frage, wie sich diese beiden Konzepte in theologischen Diskursen sowie in praktischen Feldern wie der islamischen Seelsorge oder dem interreligiösen Dialog gestalten lassen und plädierte für eine integrative Perspektive, die sowohl die Verletzlichkeit als auch die Widerstandskraft des Menschen berücksichtigt.
Abschließend widmete sich Dr. David Koch, Universität Münster, in seinem Vortrag der kritischen Männlichkeitsforschung im theologischen Kontext. Anhand des Begriffs der Resilienz analysierte er die Darstellungen sogenannter „Männlichkeitsinfluencer“, die Resilienz primär als mentale Widerstandskraft im Sinne eines kämpferischen Idealbilds männlicher Stärke deuteten. Diese Form der Resilienznarrative trägt laut Koch zur ideologischen Aufladung von Männlichkeit und zur Legitimierung eines radikalen Männerbildes bei. Koch führt dieses Phänomen auf die semantische Männlichkeitsprägung des Gottesbildes in den abrahamitischen Religionen („Vergeschlechtlichung“ Gottes) zurück, die dazu geführt habe, dass bis in die heutige Zeit hegemoniale Männlichkeitsideale in das Gottesbild projiziert werden.
Die Beiträge des Fachcolloquiums verdeutlichten das Potenzial und die Relevanz wissenschaftlicher Forschungsansätze zum Themenfeld „Resilienz in islamischer Tradition“ und zeigten Perspektiven für die Weiterentwicklung von methodischen Ansätzen aus benachbarten Forschungsdisziplinen auf. Es wurden zum einen Konzepte aus der islamischen Tradition herausgearbeitet, die mit dem Resilienzbegriff eine semantische Ähnlichkeit aufweisen und als Ressourcen für Resilienz aus einem islamischen Kontext heraus interpretiert werden können. Dies wurde vor allem im koranischen und im sufischen Sprachkontext deutlich. Zum anderen wurden Parallelen dieser Konzepte zur christlichen Tradition hervorgehoben und dabei festgestellt, dass Resilienz nicht ausschließlich Eigenschaften von innerer Stärke umfasst, sondern Leiderfahrung und Verletzlichkeit miteinschließt. In der abschließenden Diskussion wurde die gegenwartsbezogene Relevanz der Thematik für die islamisch-theologische Forschung betont und zur Entwicklung weiterer Ansätze zum Themenspektrum Resilienz aus einer islamischen Perspektive angeregt.