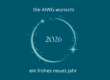KI, Gott – neue Perspektiven bei plugether
Zum letzten Mal in diesem Jahr trafen sich Teilnehmer_innen aus ganz Deutschland in Frankfurt, um zusammen Video-Content zu kreieren. Zwei Tage lang entwickelten sie gemeinsam Ideen für TikTok-Videos, diskutierten Fragen rund um Religion und Gesellschaft und setzten das Gelernte praktisch um. Professionell begleitet wurden sie dabei von zwei Content Creatoren. Abgerundet wurde der Workshop durch eine Lesung und Diskussion mit der Buchautorin Melina Borčak.
Mit einem digitalen Auftakt am 10. September startete die dritte Workshopreihe von plugether, bei dem Creatorin Rosa Jellinek das notwendige Know-how zur Produktion wirkungsvoller TikTok-Inhalte vermittelte. „Wie werde ich als (religiöser) Mensch wahrgenommen und wie kann ich meine Perspektiven in der Gesellschaft stärker als Ressource sichtbar machen?“ Über diese und andere Fragen diskutierten die Teilnehmenden dann am 22. und 23. September persönlich. Begleitet wurden sie von Anton Hartmann, der auf seinem kooperativen Kanal aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen nachgeht und Mehmet Koc, der als Sozialarbeiter und über Social Media zu (Jugend-)Extremismus, Demokratieförderung und weiteren Themen Aufklärungsarbeit leistet.
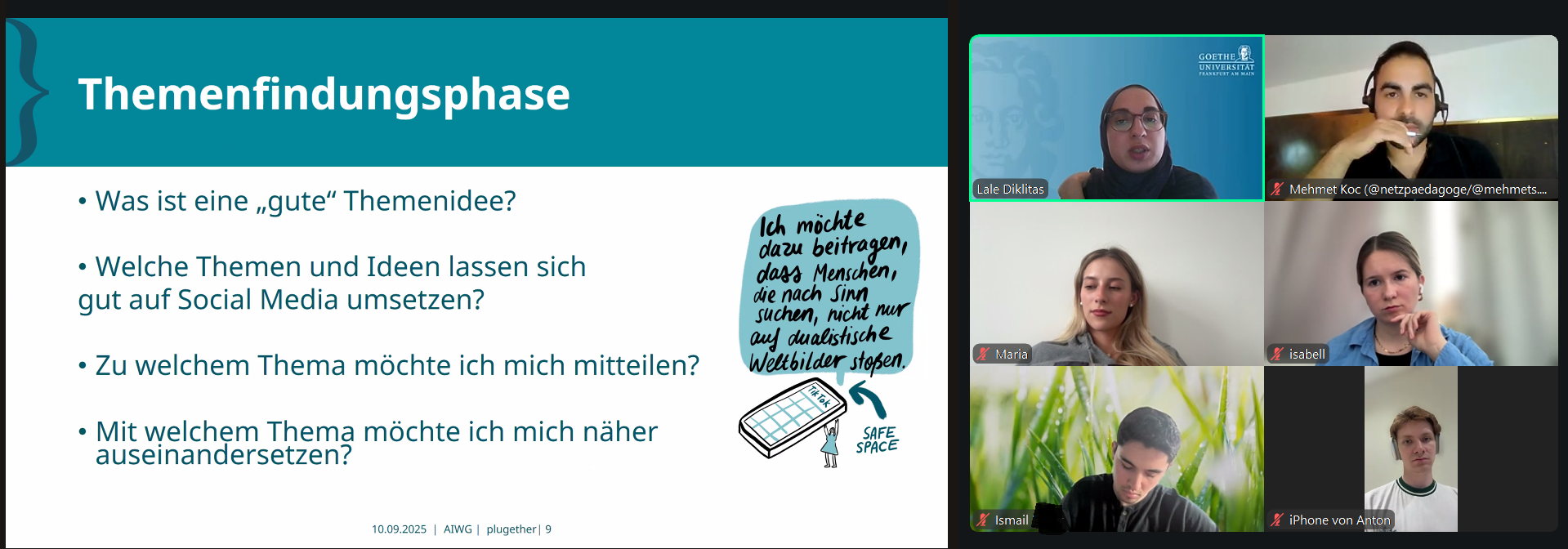
Das Ergebnis sind kreative und individuelle TikTok-Videos mit großer Bandbreite: Angefangen von KI, über religiöse Ethik bis hin zu persönlichem Glaubenszugang und Sprachfähigkeit bei tabuisierten Themen formten sich ganz unterschiedliche Video-Ideen auf Grundlage der jeweiligen Erfahrungen und Expertisen. Ihre Videos verdeutlichen, dass Religion in der öffentlichen Wahrnehmung zwar oft negativ konnotiert ist – aber für Menschen persönlich wie auch gesellschaftlich eine immense Ressource bietet.
Ein besonderes Highlight der Workshopreihe war die Lesung mit Melina Borčak. Die Journalistin und Buchautorin von „Mekka hier, Mekka da. Wie wir über antimuslimischen Rassismus sprechen müssen“ zeigte, wie Rassismus in Deutschland mit besonderem Fokus auf antimuslimischem Rassismus nicht nur offen, sondern auch unbewusst und strukturell wirkt. Neben einem aktiven Rassismus gebe es den passiven, strukturellen Rassismus, der im System verankert sei und wovon Menschen unbewusst Teil würden. Offen rassistische Äußerungen und Handlungen seien daher nur die Spitze des Eisbergs – strukturelle Faktoren, etwa mangelnde Teilhabemöglichkeiten in Institutionen, trügen dazu bei, gesellschaftliche Missstände aufrechtzuerhalten. Borčak ist ebenfalls auf Social Media aktiv und verdeutlicht dort, wie Plattformen genutzt werden können, um über Rassismus aufzuklären, indem sie Konzepte wie „White Fragility“ und „Tokenism“ erläutert.

Am Ende der zwei Tage in Frankfurt zogen die Teilnehmenden ein positives Fazit: „Fachlich wie auch zwischenmenschlich war es ein sehr bereichernder Workshop“, „respektvoll und auf Augenhöhe“. Wie kommen die Videos, die in Frankfurt entstanden sind, auf TikTok an und wie können unsere Teilnehmenden auf kritische Kommentare reagieren? Darum wird es Ende Oktober beim letzten Termin zu Community Management gehen. Den krönenden Abschluss des Projekts bildet das große Wiedersehen am 15. November, zu dem sämtliche Teilnehmende eingeladen sind.