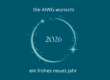Was kann der IRU von jüdischen und christlichen Konzepten lernen?
Am 19. und 20. September 2025 fand in der Katholischen Akademie Schwerte die dritte Konsultation der AIWG-Projektwerkstatt „Religiöse Bildung an den Lernorten Schule und Moschee – eine Verhältnisbestimmung“ statt. Das Kooperationsprojekt der Universitäten Osnabrück und Paderborn unter Leitung von Prof. Annett Abdel-Rahman und Prof. Naciye Kamcili-Yildiz widmete sich erneut den zentralen Forschungsfragen nach dem Verhältnis sowie den Aufgaben und Zielen religiöser Bildung an beiden Lernorten.
Während die ersten beiden Konsultationen die spezifischen Charakteristika von Schule und Moschee untersuchten, stand diesmal die Frage im Mittelpunkt, welche Einsichten und Impulse der islamische Religionsunterricht aus den Entwicklungen jüdischer und christlicher Religionspädagogik gewinnen kann. Dabei ging es insbesondere um folgende Aspekte: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen zwischen dem jüdischen, christlichen und islamischen Religionsunterricht? Und wie gehen diese mit dem Spannungsverhältnis zwischen tradierten Vorstellungen – etwa dem Einüben religiöser Praktiken und dem Umgang mit religiösen Normen – und den Anforderungen des schulischen Kontextes um?
Bruno Landthaler, Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, führte in die Besonderheiten jüdischer Religionspädagogik ein. Er zeigte, wie sich religiöses Lernen im Judentum im Zuge der jüdischen Aufklärung (Haskala) grundlegend wandelte: Ausgehend vom traditionellen Thora-Lernen, das früher ausschließlich Jungen und jungen Männern in der Synagoge vorbehalten war, entstanden jüdische Schulen, die neben religiösen Inhalten auch weltliche Fächer einführten und Mädchen wie Jungen gleichermaßen einbezogen. Damit entwickelte sich schrittweise ein moderner jüdischer Religionsunterricht, der Bildung im umfassenden Sinn verstand. Landthaler betonte die klare Unterscheidung zwischen schulischem und gemeindlichem Religionsunterricht. Der schulische Religionsunterricht erstreckt sich über die gesamte Schulzeit, zielt auf eine sprach- und dialogfähige Auseinandersetzung mit dem Judentum und versteht sich nicht als religiöse Unterweisung. Der gemeindliche Religionsunterricht hingegen findet in Vorbereitung auf die Bar/Bat-Mizwa statt, vermittelt religiöse Praxis und befähigt zur Teilnahme am Gottesdienst. Zugleich verwies Landthaler auf aktuelle Entwicklungen: Jüdischer Religionsunterricht wird heute sowohl an staatlichen als auch an jüdischen Schulen erteilt, bleibt aber organisatorisch und rechtlich vielfach ein Sonderfall. Lehrkräfte werden vor allem an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg ausgebildet, die als zentrale Institution für jüdische Religionspädagogik in Deutschland gilt.
Clauß Peter Sajak, Universität Münster, analysierte die Entwicklung des katholischen Religionsunterrichts in Deutschland. Einen entscheidenden Wendepunkt markierte die Würzburger Synode (1971-1975), die erstmals eine klare Trennung zwischen schulischem Religionsunterricht und gemeindlicher Katechese formulierte. Der schulische Religionsunterricht soll Schüler_innen zur eigenständigen Glaubensentscheidung befähigen, gemeindliche Formen religiöser Bildung hingegen dienen der Vertiefung bereits getroffener Entscheidungen. Dabei geht es im schulischen Religionsunterricht nicht um Glaubensunterweisung, sondern um die Vermittlung einer Glaubensperspektive, die die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen ermöglicht und so zu einer persönlichen Glaubensentscheidung führen kann. Sajak wies darauf hin, dass sich der schulische Religionsunterricht lange Zeit überwiegend auf die Vermittlung religiösen Wissens konzentrierte und in jüngerer Zeit erfahrungsbezogene und praxisorientierte Lernformen wieder an Bedeutung gewinnen.
Der Austausch über jüdische und katholische Ansätze zeigte, dass schulischer Religionsunterricht zunehmend von Dialogfähigkeit, Lebensweltbezug und Reflexion über religiöse Praxis geprägt ist. Zugleich verdeutlichten die Diskussionen und Beispiele, dass jede religiöse Bildungstradition ihre eigenen historischen Entwicklungen, institutionellen Rahmenbedingungen und theologischen Zielsetzungen hervorgebracht hat – und dass dies ebenso für den islamischen Religionsunterricht gilt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Unterscheidung zwischen schulischem und gemeindlichem Lernen weiter zu schärfen, die religiöse Sprachfähigkeit der Lernenden zu fördern und die Beziehung zwischen Glaubenspraxis und Bildungsauftrag systematisch zu reflektieren.
Die AIWG-Projektwerkstatt wird mit einer vierten Konsultation fortgesetzt, um die gewonnenen Einsichten weiter auszuarbeiten und für die Praxis islamischer religiöser Bildung nutzbar zu machen.